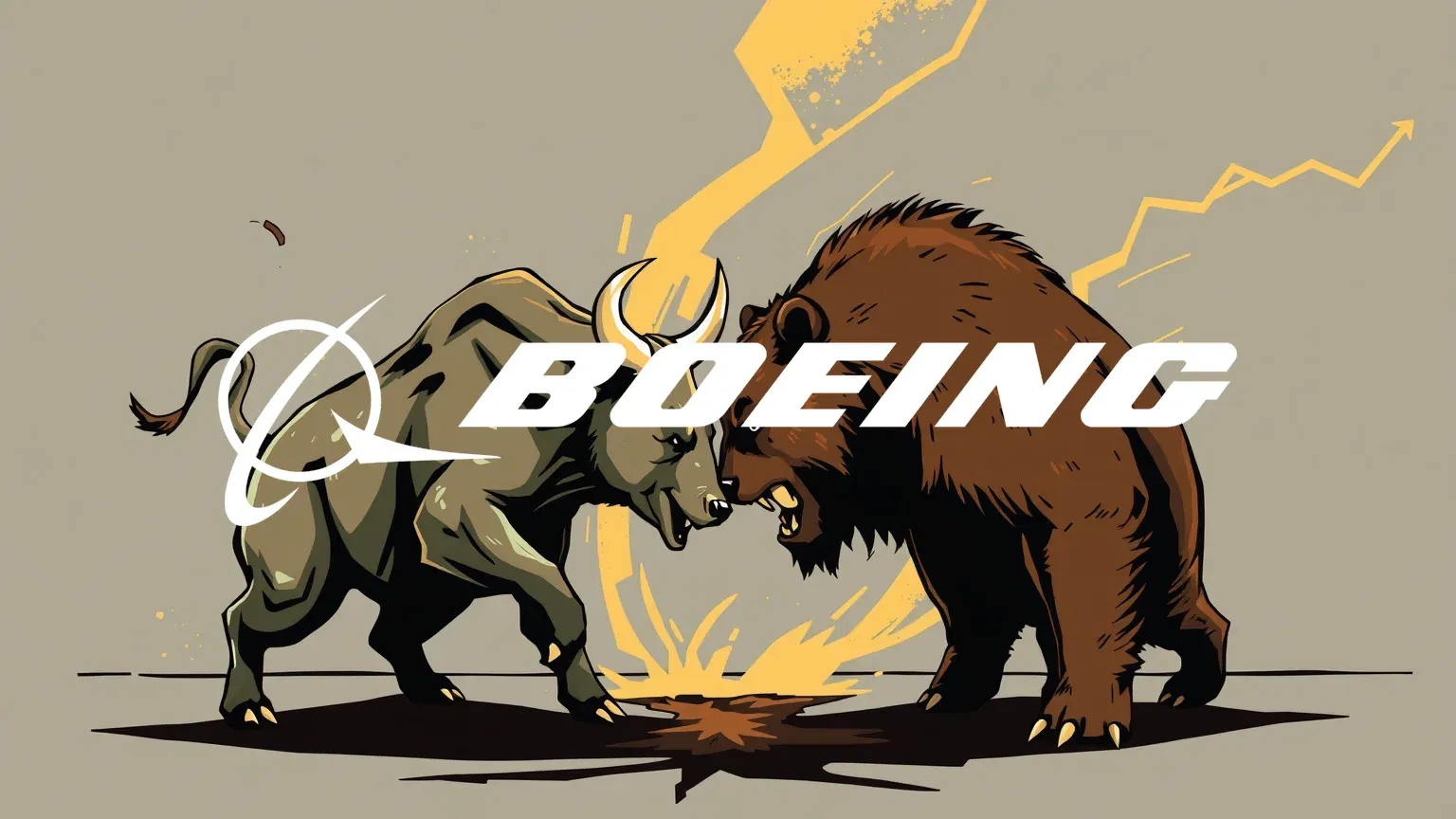Im globalen Wirtschaftsgeschehen zeichnet sich für das Frühjahr 2025 ein Muster zunehmender Spannungen ab. Während China mit einem kritischen Mangel an NVIDIA-KI-Chips kämpft, verschärft US-Präsident Trump seine Zollpolitik gegenüber Europa und Kanada. Diese Entwicklungen finden vor dem Hintergrund globaler geldpolitischer Anpassungen statt, die das Finanzmarktgeschehen maßgeblich beeinflussen.
NVIDIA-Chip-Engpass bedroht Chinas KI-Ambitionen
Der führende chinesische Serverhersteller H3C warnt in einer aktuellen Kundennotiz vor erheblichen Engpässen bei NVIDIAs H20-Chips – den fortschrittlichsten KI-Prozessoren, die unter US-Exportkontrollen legal in China verfügbar sind. „Die internationale Lieferkette für H20 steht vor erheblichen Unsicherheiten“, teilte das Unternehmen mit und fügte hinzu, dass die derzeitigen Lagerbestände nahezu erschöpft seien. Neue Lieferungen werden erst Mitte April erwartet, wobei auch die Pläne über diesen Zeitpunkt hinaus mit Unsicherheiten behaftet sind.
Die Knappheit der H20-Chips könnte für Chinas KI-Ambitionen zum Problem werden, da führende Technologieunternehmen wie Tencent, Alibaba und ByteDance ihre Bestellungen seit Anfang des Jahres deutlich erhöht haben. Der Grund: die wachsende Beliebtheit der kosteneffizienten KI-Modelle des chinesischen Startups DeepSeek.
Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den wachsenden chinesischen Kapitalabflüssen nach Hongkong, die laut Eddie Yue, Leiter der Hongkonger Währungsbehörde, in den kommenden Jahren die größte Chance für die Finanzmärkte des Stadtstaats darstellen könnten. Die Zahl der chinesischen Anlegerkonten im Rahmen des Wealth-Connect-Programms stieg nach der Lockerung der Regeln im Februar 2024 innerhalb von 12 Monaten von 25.000 auf 95.000 an.
Trumps Zollpolitik verschärft transatlantische Handelsbeziehungen
Während China mit Technologieengpässen kämpft, droht Präsident Trump mit neuen Handelskonflikten. Er kündigte an, „großflächige Zölle, weit größer als derzeit geplant“ gegen die EU und Kanada zu verhängen, falls diese den USA „wirtschaftlichen Schaden“ zufügen sollten. Diese Drohung folgt auf seine jüngste Ankündigung von 25-prozentigen Zöllen auf Automobilimporte, die am 3. April 2025 in Kraft treten sollen.
Der kanadische Premierminister Mark Carney bezeichnete die Autozölle als direkten Angriff auf kanadische Arbeitnehmer und erklärte, dass Ottawa über mögliche Gegenmaßnahmen nachdenke. Er betonte, dass die Ankündigung gegen das während Trumps erster Amtszeit unterzeichnete Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko verstoße.
Auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagierte mit Bedauern auf die US-Autozölle, die die europäische Automobilindustrie hart treffen könnten. Besonders betroffen ist Volkswagen mit 43% seiner US-Verkäufe aus Mexiko, aber auch Mercedes-Benz, BMW und Porsche stehen unter erheblichem Druck.
NATO-Chef warnt vor Alleingängen in der Sicherheitspolitik
Die Handelsstreitigkeiten fallen in eine Zeit wachsender Spannungen innerhalb der transatlantischen Allianz. NATO-Generalsekretär Mark Rutte warnte die Vereinigten Staaten und Europa eindringlich davor, in Sicherheitsfragen „Alleingänge“ zu unternehmen. „Lassen Sie mich absolut deutlich sein, dies ist nicht die Zeit, alleine zu gehen. Weder für Europa noch für Nordamerika“, betonte Rutte in einer Rede an der Warschauer Wirtschaftsschule.
Rutte rief zu transatlantischer Einheit auf, nachdem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Vizepräsident JD Vance sich laut Medienberichten kritisch über die europäischen Verbündeten geäußert hatten. Trump selbst hatte zuvor Zweifel an der Bereitschaft Washingtons gesät, NATO-Verbündete zu verteidigen, die nicht genug für ihre eigene Verteidigung ausgeben würden.
Mehrere europäische Länder, darunter Deutschland und Großbritannien, haben inzwischen Pläne zur Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben angekündigt. Trump fordert von den NATO-Mitgliedern Ausgaben in Höhe von 5% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung – deutlich mehr als das aktuelle Ziel von 2% und ein Niveau, das kein NATO-Land, einschließlich der USA, derzeit erreicht.
Globale Zentralbanken navigieren durch unsichere Gewässer
Vor diesem Hintergrund geopolitischer Spannungen stehen Zentralbanken weltweit vor komplizierten geldpolitischen Entscheidungen. Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt Banken im Euroraum, sich auf geopolitische Schocks und makrofinanzielle Bedrohungen vorzubereiten. Claudia Buch, EZB-Aufsichtschefin, betonte: „Eine potenzielle Verschlechterung der Vermögensqualität und mögliche wirtschaftliche Störungen durch geopolitische Konflikte oder die Auswirkungen finanzieller Sanktionen erfordern erhöhte Aufmerksamkeit, ausreichendes Kapital sowie robuste Governance- und Risikomanagement-Systeme bei den Banken.“
In Norwegen hielt die Zentralbank entgegen früherer Ankündigungen den Leitzins auf einem 17-Jahres-Hoch von 4,50%. Der Grund für diese überraschende Kehrtwende war ein unerwarteter Anstieg der Kerninflation auf 3,4% im Februar, deutlich über dem Zielwert von 2%.
In Indien hingegen wird die Zentralbank laut einer Reuters-Umfrage bei ihrer Sitzung am 9. April zum zweiten Mal in Folge den Leitzins senken. Mit voraussichtlich nur einer weiteren Senkung im August würde dies den kürzesten Lockerungszyklus aller Zeiten markieren. Die indische Inflation ist im Februar auf ein Sieben-Monats-Tief von 3,61% gesunken, während das Wirtschaftswachstum mit prognostizierten 6,4% im laufenden Fiskaljahr das schwächste seit vier Jahren sein dürfte.
Europäische Banken suchen Kapitalvorteile bei der EZB
In Europa bemühen sich die spanischen Großbanken Santander und BBVA um eine günstigere Kapitalbehandlung ihrer Versicherungsgeschäfte durch die Europäische Zentralbank. Bislang haben die meisten spanischen Banken ihre Versicherungsgeschäfte direkt von ihrem Kapital abgezogen, mit Ausnahme derjenigen, die vom europäischen Bankenaufseher als Finanzgruppe unter verstärkter Aufsicht betrachtet werden – dem sogenannten „dänischen Kompromiss“.
Der dänische Kompromiss, der seit Jahresbeginn dauerhaft etabliert wurde, ermöglicht es Banken, ihre Versicherungsinvestitionen risikobezogen zu gewichten, anstatt sie vollständig von ihrem Kapital abzuziehen. Die EZB hat angekündigt, fallweise zu entscheiden, wann diese Regelung gewährt wird.
Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Banken zunehmend auf das Versicherungsgeschäft als Wachstumsmotor setzen, um in einem Umfeld sinkender Zinsen rückläufige Zinsmargen durch höhere Provisionen aus dem Private Banking und Asset Management auszugleichen.
Indonesien beruhigt Investoren nach Börsen- und Währungsrutsch
Während die Finanzwelt mit Handelsspannungen und geldpolitischen Anpassungen ringt, versucht Indonesien, Investoren nach einem massiven Ausverkauf an der Börse und einem Währungseinbruch zu beruhigen. Die indonesische Rupiah ist auf den schwächsten Wert seit 1998 gefallen, während der Hauptaktienindex letzte Woche um bis zu 7,1% einbrach.
Präsident Prabowo Subianto plant nach den Eid-al-Fitr-Feiertagen ein Treffen mit Investoren, um Fehlwahrnehmungen über die Regierungspolitik zu korrigieren. „Die Regierung wird die Kommunikation mit Wirtschaftsakteuren verbessern und intensivieren“, sagte Raden Pardede, ein Sonderberater des indonesischen Wirtschaftsministers Airlangga Hartarto. Die Hauptbotschaften werden Zusicherungen umfassen, dass die Regierung die gesetzliche Obergrenze für das Haushaltsdefizit von 3% des BIP nicht überschreiten wird und keine politische Einmischung in den neu eingerichteten Staatsfonds Danantara Indonesia erfolgen wird.
Die indonesische Zentralbank erklärte sich bereit, ihre Interventionen zur Stabilisierung der Währung fortzusetzen, betonte jedoch, dass die wirtschaftlichen Indikatoren auf eine grundlegende Stärke des Landes hindeuten und die Situation „völlig anders“ sei als während der Finanzkrise 1998.
Die sich verschärfenden Handelsspannungen, geopolitische Unsicherheiten und geldpolitische Herausforderungen zeigen, dass die globalen Märkte vor einem komplizierten Frühjahr stehen, in dem sowohl politische Entscheidungen als auch technologische Engpässe die wirtschaftliche Landschaft nachhaltig prägen könnten.