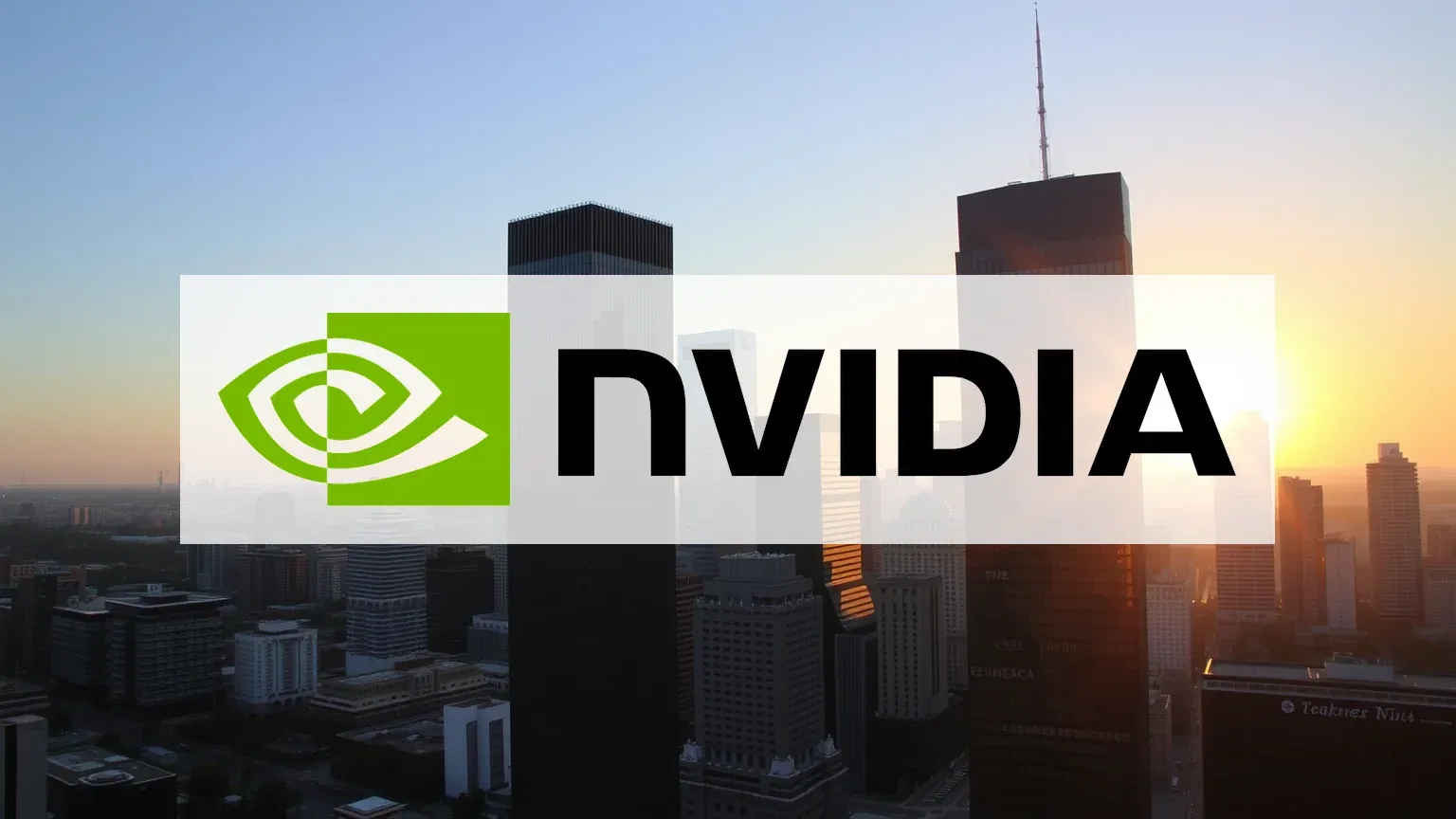Die Goldpreise haben am Freitag erstmals die Marke von 3.200 US-Dollar pro Unze durchbrochen, während der US-Dollar gegenüber wichtigen Währungen auf Talfahrt ging. Dieser drastische Vertrauensverlust in US-Vermögenswerte ist eng verknüpft mit der eskalierenden Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump, die weltweit für massive Marktturbulenzen sorgt.
Dollar-Einbruch treibt Gold auf Rekordhoch
Der Goldpreis kletterte am Freitag um 0,7% auf 3.195,09 Dollar je Unze und erreichte im frühen Handel ein neues Allzeithoch von 3.219,84 Dollar. Allein diese Woche verzeichnete das Edelmetall einen Wertzuwachs von etwa 5%. Experten sehen den rasanten Dollarverfall als Haupttreiber dieser Entwicklung. "Das scheint einen anhaltenden Exodus aus dollarbasierten Anlagen widerzuspiegeln, wobei Aktien- und Anleiheverkäufe inmitten der Unsicherheit über die Zollpolitik zunehmen", erklärte Ilya Spivak, Leiter für globale Makrostrategie bei Tastylive.
Der US-Dollar verlor gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenzwährungen deutlich an Wert. Besonders stark waren die Einbußen gegenüber dem Schweizer Franken mit einem Minus von bis zu 1,2% auf 0,81405 – der niedrigste Stand seit Januar 2015. Auch zum japanischen Yen gab der Greenback um 1,1% auf 142,88 nach, während der Euro um 1,7% auf 1,13855 Dollar stieg – ein Niveau, das zuletzt im Februar 2022 erreicht wurde.
Handelskrieg mit China verschärft sich
Während Trump am Mittwoch überraschend eine 90-tägige Aussetzung der angekündigten Strafzölle für eine Vielzahl von Handelspartnern verkündete, nahm er China ausdrücklich von dieser Pause aus. Stattdessen erhöhte er die Zölle auf chinesische Importe auf effektiv 145%, was die Konfrontation zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter anheizen dürfte.
China hat seinerseits mit Gegenmaßnahmen reagiert und Zölle von 84% auf amerikanische Waren verhängt. Der chinesische Yuan war zunächst auf ein Allzeittief im Offshore-Handel gefallen, erholte sich jedoch später wieder. Die Handelsspannungen könnten den Warenaustausch zwischen beiden Volkswirtschaften um bis zu 80% reduzieren, wie die Welthandelsorganisation am Mittwoch warnte.
Wachstumsprognosen werden gesenkt
Angesichts der verschärften Handelskonflikte haben mehrere Großbanken ihre Wachstumsprognosen für China nach unten korrigiert. Goldman Sachs senkte seine BIP-Prognose für 2025 von 4,5% auf 4,0%, während Citi seine Vorhersage von 4,7% auf 4,2% reduzierte. Auch für andere Volkswirtschaften werden negative Auswirkungen erwartet.
Die britische Wirtschaft, die im Februar überraschend stark um 0,5% gewachsen war, könnte ebenfalls unter Druck geraten. Anleger befürchten, dass die globalen Handelsspannungen Unternehmensausgaben und Verbrauchervertrauen belasten werden. "Die Erhöhung der Unternehmenssteuern im April und das klare Risiko, dass die Zweitrundeneffekte höherer US-Zölle auf die britische Wirtschaft das BIP-Wachstum unter unsere ohnehin unterdurchschnittliche Prognose von 0,8% für 2025 und 1,2% für 2026 drücken könnten", warnen Analysten von Capital Economics.
Marktvolatilität erreicht Krisenniveau
Die Börsen weltweit wurden von wilder Volatilität erfasst. Der amerikanische S&P 500 fiel am Donnerstag um 3,5%, nachdem er am Vortag um 9,5% gestiegen war – der größte Tagesgewinn seit Oktober 2008 während der Finanzkrise. Der Index liegt nun 14,3% unter seinem Rekordhoch vom 19. Februar.
Der Volatilitätsindex CBOE, auch bekannt als "Angstbarometer" der Wall Street, stieg zeitweise auf fast 55 Punkte – mehr als das Dreifache seines langfristigen Medianwerts. In der vergangenen Woche erreichte der Index einige der höchsten Werte seit Beginn der COVID-19-Krise vor fünf Jahren. Am Mittwoch verzeichnete der S&P 500 mit einer Handelsspanne von 10,7% innerhalb eines Tages die fünftgrößte Tagesschwankung der letzten fünfzig Jahre.
EU bereitet sich auf Zollkonsequenzen vor
Die Europäische Union nutzt die 90-tägige Aussetzung der höheren US-Zölle, um sich strategisch vorzubereiten. "Die Tatsache, dass wir 90 Tage Aufschub haben, ist, offen gesagt, sehr hilfreich, denn das bedeutet, dass wir jetzt strategisch vorgehen können", sagte ein hochrangiger EU-Beamter. Die EU-Finanzminister werden am Freitag über eine koordinierte Reaktion beraten.
Die von Trump ursprünglich geplanten Zölle hätten erhebliche Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft gehabt. Die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission schätzen, dass sie das BIP der EU um 0,5% bis 1,0% reduzieren könnten – was angesichts einer Wachstumsprognose von nur 0,9% für dieses Jahr die EU in eine Rezession stürzen könnte.
Handelsbarrieren als Zollersatz
Als Teil ihrer Reaktion auf die US-Handelspolitik werden die EU-Minister wahrscheinlich auch auf die Reduzierung von Handelsbarrieren innerhalb der EU setzen. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass innereuropäische Handelshemmnisse einem Zoll von 44% auf Waren und 110% auf Dienstleistungen entsprechen. Die Verringerung dieser Hindernisse könnte ein Schlüsselelement der EU-Antwort auf die US-Zölle sein.
Die EU arbeitet gleichzeitig an einem Handelsabkommen mit Washington, das möglicherweise einen Nulltarif für alle Industriegüter vorsieht. Sollte es keine Einigung geben, müssten die 27 EU-Regierungen den am stärksten betroffenen Branchen – Stahl, Aluminium, Autos, Holz und Pharmazeutika – unter die Arme greifen. Auf Stahl, Aluminium und Autos gelten bereits US-Zölle in Höhe von 25%.
Infrastrukturinvestitionen als Konjunkturmotor
Während Handelsspannungen die Weltwirtschaft belasten, setzen einige Länder auf Infrastrukturinvestitionen als Wachstumstreiber. Italien baut mit EU-Mitteln eine neue Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Neapel am Mittelmeer und Bari an der Adriaküste. Die 145 Kilometer lange Strecke wird die Fahrzeit von derzeit vier auf nur zwei Stunden verkürzen.
Das Projekt mit Kosten von etwas mehr als 6 Milliarden Euro wird zu fast einem Viertel aus dem COVID-19-Wiederaufbaufonds der EU finanziert. Der süditalienische Thinktank Svimez schätzt, dass allein in der Bauphase rund 4 Milliarden Euro an neuen Geschäften und 62.000 Arbeitsplätze entstehen werden.
Ausblick: Unsicherheit bleibt bestimmender Faktor
Trotz der vorübergehenden Entspannung durch Trumps teilweisen Rückzug von den Zolldrohungen bleibt die Unsicherheit an den Märkten hoch. "Das schlimmste Szenario im Handel wurde vermieden, aber es ist nicht alles so schön und gut, wie wir es gerne hätten", sagte Michael Brown, Senior Research Strategist bei Pepperstone. "Wir haben jetzt 90 Tage enorme Unsicherheit eingebaut."
Die unberechenbare Handelspolitik von Trump – mit wiederholten Drohungen und kurzfristigen Rückziehern – hat Weltführer verwirrt und Unternehmensführer verunsichert. Diese Volatilität dürfte die Märkte weiterhin prägen, während Investoren nach neuen Sicherheiten suchen. Gold, der Schweizer Franken und andere traditionelle "sichere Häfen" könnten davon profitieren, während der US-Dollar und dollarbasierte Vermögenswerte unter Druck bleiben dürften.