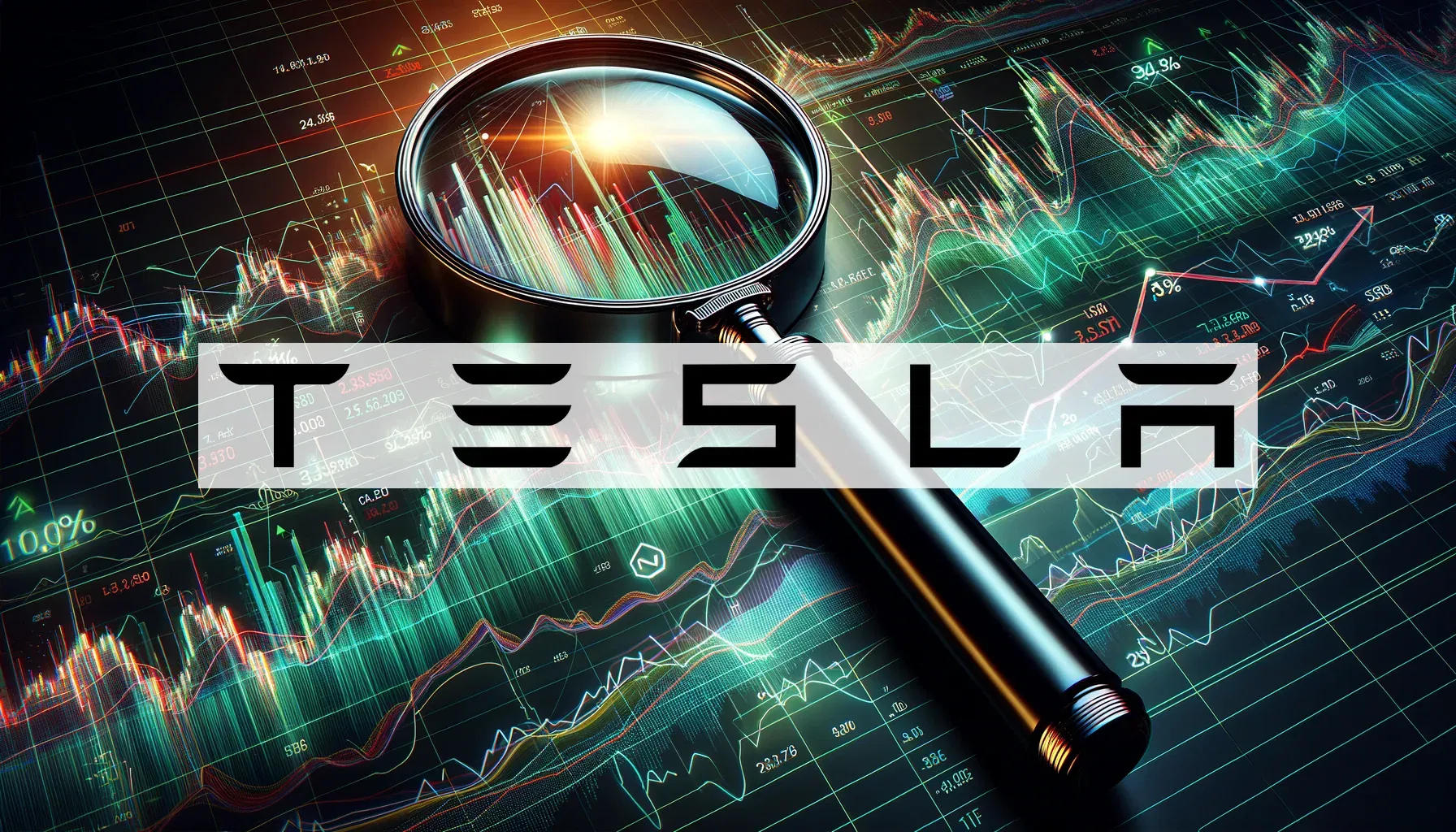Am Vorabend des von Donald Trump als „Liberation Day“ bezeichneten 3. April 2025 halten die internationalen Finanzmärkte den Atem an. Der US-Präsident wird morgen seinen lang erwarteten Plan für gegenseitige Zölle vorstellen, was bereits jetzt deutliche Spuren in der globalen Wirtschaftslandschaft hinterlässt.
Goldpreis erreicht historisches Rekordhoch
Angesichts der wachsenden Unsicherheit über die kommenden Handelsbarrieren flüchten Investoren verstärkt in sichere Anlagen. Gold hat dabei zum vierten Mal in Folge ein Allzeithoch erreicht und notiert aktuell bei 3.148,88 Euro pro Unze. „Neben der allgemeinen Risikoaversion erhöhen Investoren ihre Goldallokation, da die Handelspolitik der Trump-Administration den besonderen Reservestatus des Dollars bedroht“, erklärt Kyle Rodda, Senior-Analyst bei Capital.com.
Das Edelmetall verzeichnete im vergangenen Quartal seinen stärksten Anstieg seit 1986 – einer der bedeutendsten Aufwärtstrends in der Geschichte des Goldes. Während technische Indikatoren auf eine kurzfristige Überbewertung hindeuten, dürfte die Unsicherheit rund um die bevorstehenden Zölle den Aufwärtstrend vorerst stützen. Marktbeobachter sehen bereits die 3.200-Dollar-Marke als nächstes Ziel.
Exportnationen in Alarmbereitschaft
Besonders die exportabhängigen Volkswirtschaften Asiens blicken mit Sorge auf die kommenden Handelsbeschränkungen. In Südkorea, der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens, stiegen die Exporte im März zwar um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, blieben jedoch hinter den Markterwartungen zurück.
„Ab April werden die Exporte voraussichtlich zurückgehen, wenn die gegenseitigen Zölle und Abgaben auf Automobile in Kraft treten“, warnt Wirtschaftsexpertin Chun Kyu-yeon von Hana Securities. Der südkoreanische Finanz-Vizepräsident Han Duck-soo betonte bei einem Treffen mit den Führungskräften von Samsung, Hyundai, SK und LG: „Die Unsicherheit im globalen Handelsumfeld ist zu einer enormen Bedrohung für unsere exportorientierte Wirtschaft geworden.“
Besonders besorgniserregend: Während die Exporte von Halbleitern um beachtliche 11,9 Prozent zulegten, verzeichneten Stahlprodukte einen dramatischen Einbruch von 10,6 Prozent – der stärkste Rückgang seit Juni 2024. Südkorea ist der viertgrößte Stahlexporteur in die USA, die bereits im letzten Monat einen 25-prozentigen Zoll auf Stahlprodukte eingeführt haben.
Russlands Wirtschaft unter Druck
Nicht nur asiatische Länder spüren wirtschaftlichen Gegenwind. Auch in Russland zieht sich die wirtschaftliche Lage zusammen. Im März verzeichnete der russische Produktionssektor seine stärkste Kontraktion seit fast drei Jahren. Der S&P Global Russia Manufacturing Purchasing Managers‘ Index (PMI) fiel auf 48,2 Punkte – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Februar-Wert von 50,2 und damit unter die entscheidende 50-Punkte-Marke, die zwischen Expansion und Kontraktion unterscheidet.
Diese Entwicklung markiert die erste Verschlechterung seit September und die signifikanteste seit April 2022. Dabei sanken die Produktionsniveaus im März besonders stark – der stärkste Rückgang seit Juli 2022. Diese wirtschaftlichen Probleme könnten sich angesichts von Trumps Drohung, Sekundärzölle auf russisches Rohöl zu erheben, noch verschärfen.
Asiatische Börsen atmen kurz durch
Während sich die makroökonomischen Aussichten eintrüben, zeigten die asiatischen Aktienmärkte am ersten Handelstag des April eine leichte Erholung nach den Turbulenzen im März. Der australische Leitindex stieg um 1 Prozent, der südkoreanische KOSPI legte um 1,9 Prozent zu, und Taiwans Aktienbarometer kletterte um 1,7 Prozent – eine willkommene Verschnaufpause nach den steilen Verlusten am Vortag.
Allerdings gaben der Hang Seng in Hongkong und der Nikkei in Japan ihre anfänglichen Gewinne von mehr als einem Prozent wieder ab und notierten nur noch leicht im Plus. Die chinesischen Blue-Chip-Werte kamen während der gesamten Sitzung nicht vom Fleck.
„Es ist möglich, dass ein erheblicher Teil der gestrigen Erholung der wichtigsten US-Indizes auf Monats- und Quartalsende-Neugewichtungen sowie Eindeckungen von Leerverkäufen vor Trumps ‚Liberation Day‘ zurückzuführen ist, angesichts der erheblichen Unsicherheit über die kommenden Entwicklungen“, analysiert Tony Sycamore von IG.
Er fügt warnend hinzu: „Die US-Aktienmärkte sind für eine Wachstums- und Gewinnverlangsamung eingepreist. Sie sind jedoch nicht für eine Rezession eingepreist, und sollte die US-Wirtschaft in eine Rezession eintreten, könnten die US-Aktienmärkte leicht um weitere 10 Prozent fallen.“
Japans Wirtschaft mit Lichtblick
Inmitten der globalen Handelsunsicherheit zeigt Japan Anzeichen einer graduellen wirtschaftlichen Erholung. Gestützt wird diese Entwicklung durch eine robuste Industrieproduktion, starke Einzelhandelsumsätze und einen stabilen Arbeitsmarkt, wie Analysten von ING berichten.
Die jüngste Tankan-Umfrage, die das Geschäftsvertrauen misst, zeichnet ein gemischtes Bild: Während große Hersteller einen leichten Rückgang des Vertrauens verzeichneten, blieb der Nicht-Produktionssektor – einschließlich Bau und Dienstleistungen – optimistisch. Diesen Optimismus führen ING-Analysten auf solides Lohnwachstum und einen Anstieg des ausländischen Tourismus zurück.
„Mit einer Inflation über 2 Prozent, gestützt durch starkes Lohnwachstum und Konsum, erwarten wir, dass die Bank of Japan im Mai eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird“, schreiben die Analysten. Sie weisen jedoch darauf hin, dass das Wirtschaftsvertrauen in den kommenden Quartalen aufgrund der US-Zölle, insbesondere auf Automobile und Stahl, nachlassen könnte.
Einzelhandel unter Druck
Während sich die makroökonomischen Turbulenzen entfalten, kämpfen Einzelhändler weltweit mit unterschiedlichen Herausforderungen. Im Vereinigten Königreich sanken die Ladenpreise im März weiter, wenn auch langsamer als im Vormonat. Laut Daten von NielsenIQ und dem British Retail Consortium (BRC) fielen die Preise um 0,4 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 0,7 Prozent im Februar.
Die Preise für Non-Food-Artikel verzeichneten einen geringeren Deflationsrückgang mit einem Minus von 1,9 Prozent, verglichen mit 2,1 Prozent im Vormonat. Besonders der Bekleidungs- und Schuhsektor erlebte eine zweistellige Deflation aufgrund geringer Nachfrage. Gleichzeitig zogen die Lebensmittelpreise an, mit einer Inflation von 2,4 Prozent im März, verglichen mit 2,1 Prozent im Februar.
In Australien sieht die Lage etwas besser aus. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Februar moderat um 0,2 Prozent, nachdem sie im Januar um 0,3 Prozent zugelegt hatten – ein Zeichen für eine vorsichtige Erholung des Konsumverhaltens nach der ersten Zinssenkung seit über vier Jahren.
„Die Grundlagen für Konsumausgaben sind weiterhin solide, mit verbessertem realem Einkommenswachstum und einem angespannten Arbeitsmarkt“, erklärt Sean Langcake, Leiter der makroökonomischen Prognosen bei Oxford Economics Australia.
Ausblick: Wirtschaft im Spannungsfeld
Mit Spannung blicken Märkte und Unternehmen auf den morgigen „Liberation Day“. Angesichts der erwarteten umfassenden Zollplanung hat Goldman Sachs die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA auf 35 Prozent angehoben und prognostiziert drei Zinssenkungen der Federal Reserve für dieses Jahr.
Während die Welt auf Trumps Ankündigung wartet, wird die Datenlage zur US-Wirtschaft diese Woche besonders aufmerksam verfolgt. Mit dem JOLTS-Bericht heute, dem ADP-Beschäftigungsbericht morgen und den monatlichen Arbeitsmarktdaten am Freitag – wenn auch Fed-Chef Jay Powell eine Rede zur wirtschaftlichen Aussicht halten wird – stehen entscheidende Indikatoren bevor.
In Europa werden EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Vorstandsmitglied Philip Lane heute auf einer Konferenz in Frankfurt sprechen, während Daten zu Verbraucherpreisen, dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und der Arbeitslosenquote im Euroraum erwartet werden.
Die kommenden Tage werden zeigen, wie robust die Weltwirtschaft angesichts der drohenden Handelskonflikte tatsächlich ist – und ob die Märkte die potenziellen Auswirkungen bereits angemessen eingepreist haben.